Bei Thrombose, Fehlgeburt und Nekrose nach dem Antiphospholipid-Syndrom suchen
Auch mehr als 30 Jahre nach der Erstbeschreibung ist das Antiphospholipid-Syndrom ein schwer zu fassendes Krankheitsbild. Es können die unterschiedlichsten Manifestationen auftreten. Der Antikörpertest wird allerdings nicht standardmäßig durchgeführt.
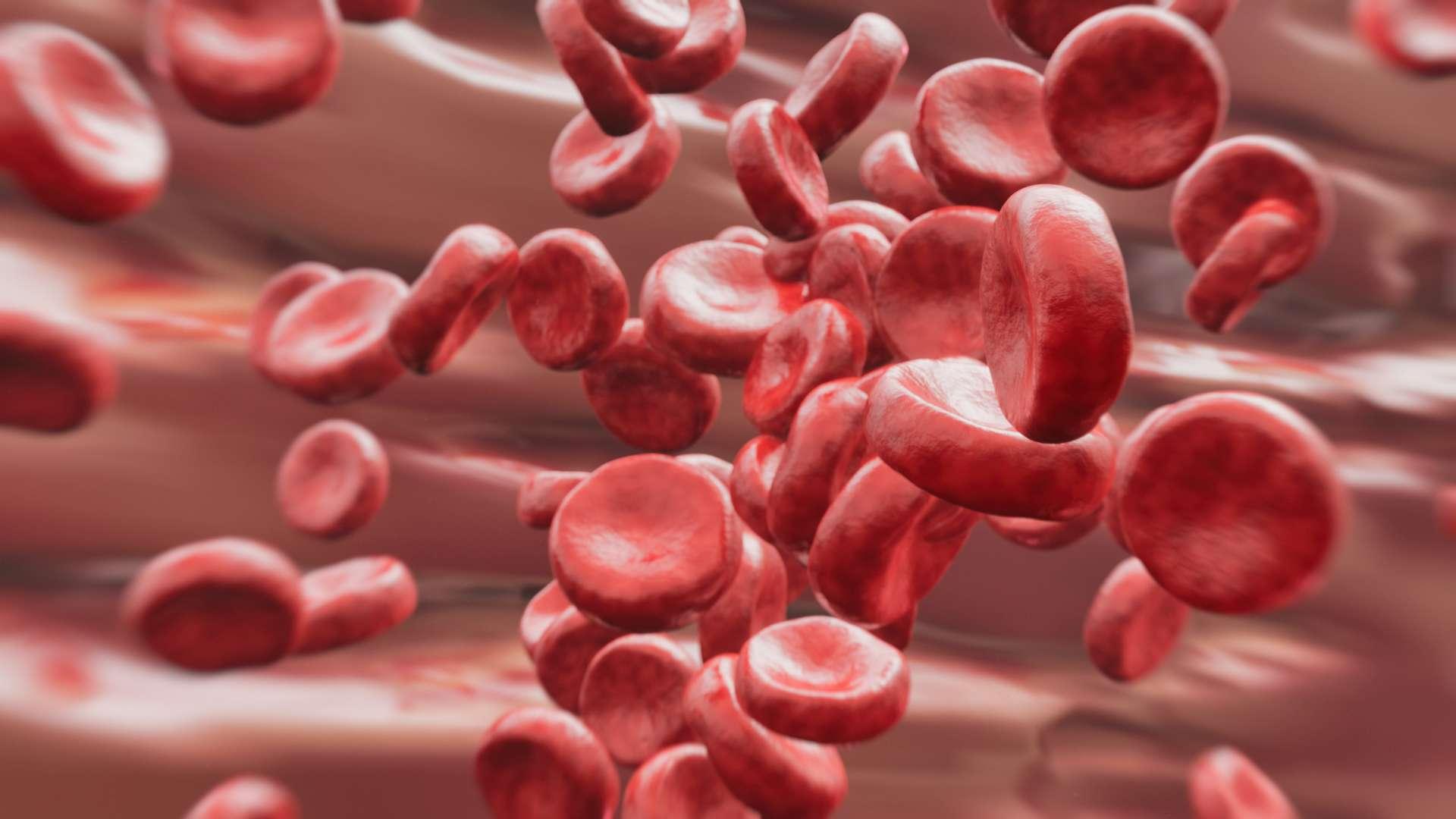
Nach den Sydney-Klassifikationskriterien kann von einem Antiphospholipid-Syndrom (APS) ausgegangen werden, wenn persistierend Antiphospholipid-Antikörper (Lupus-Antikoagulanz, Anti-Cardiolipin-IgG oder -IgM, Anti-b2-Glykoprotein-I-IgG oder -IgM) nachgewiesen wurden und mindestens eine klinische Manifestation vorliegt. Dies können vaskuläre Thrombosen und/oder eine Schwangerschaftskomplikation wie wiederholte Fehl-, Tot- oder Frühgeburten sein. Zwischen dem ersten positiven Antikörpertest und dem klinischen Ereignis sollten dabei nicht mehr als fünf Jahre liegen.
Am besten untersucht ist das APS bei Patienten mit systemischem Lupus erythematodes (SLE), da schätzungsweise 15% der Betroffenen ein APS entwickeln. Genaue Zahlen zur generellen Häufigkeit gibt es nicht, schreiben Dr. Elisabet Svenungsson und Dr. Aleksandra Antovic von der Abteilung für Rheumatologie am Karolinska-Institut in Stockholm. Insbesondere bei Thrombosen wird häufig nicht auf Antiphospholipid-Antikörper getestet.
Nach einer Metaanalyse beträgt die Prävalenz eines APS bei Patienten mit venösen Thromboembolien etwa 10%, bei ischämischen Schlaganfällen sind es 14%, bei Myokardinfarkten 11% und bei Schwangerschaftsereignissen 6%. Trotzdem gehört der Antiphospholipid-Antikörper-Test nicht zum allgemeinen Screening auf kardiovaskuläre Risikofaktoren.