Kardiovaskuläre Effekte von Rauchen und Nikotin
Beim Thema Zigarettenrauch steht schnell das Nikotin unter Generalverdacht, rauchbedingte Erkrankungen zu verursachen. Zu Unrecht, sagt Univ.-Prof. Dr. Bernd Mayer, Pharmakologe und Toxikologe an der Universität Graz. Denn sämtliche vorhandene wissenschaftlichen Daten zeichnen ein eindeutiges Bild: Das schädliche am Glimmstängel ist nicht das Nikotin, sondern die Verbrennungsprodukte.
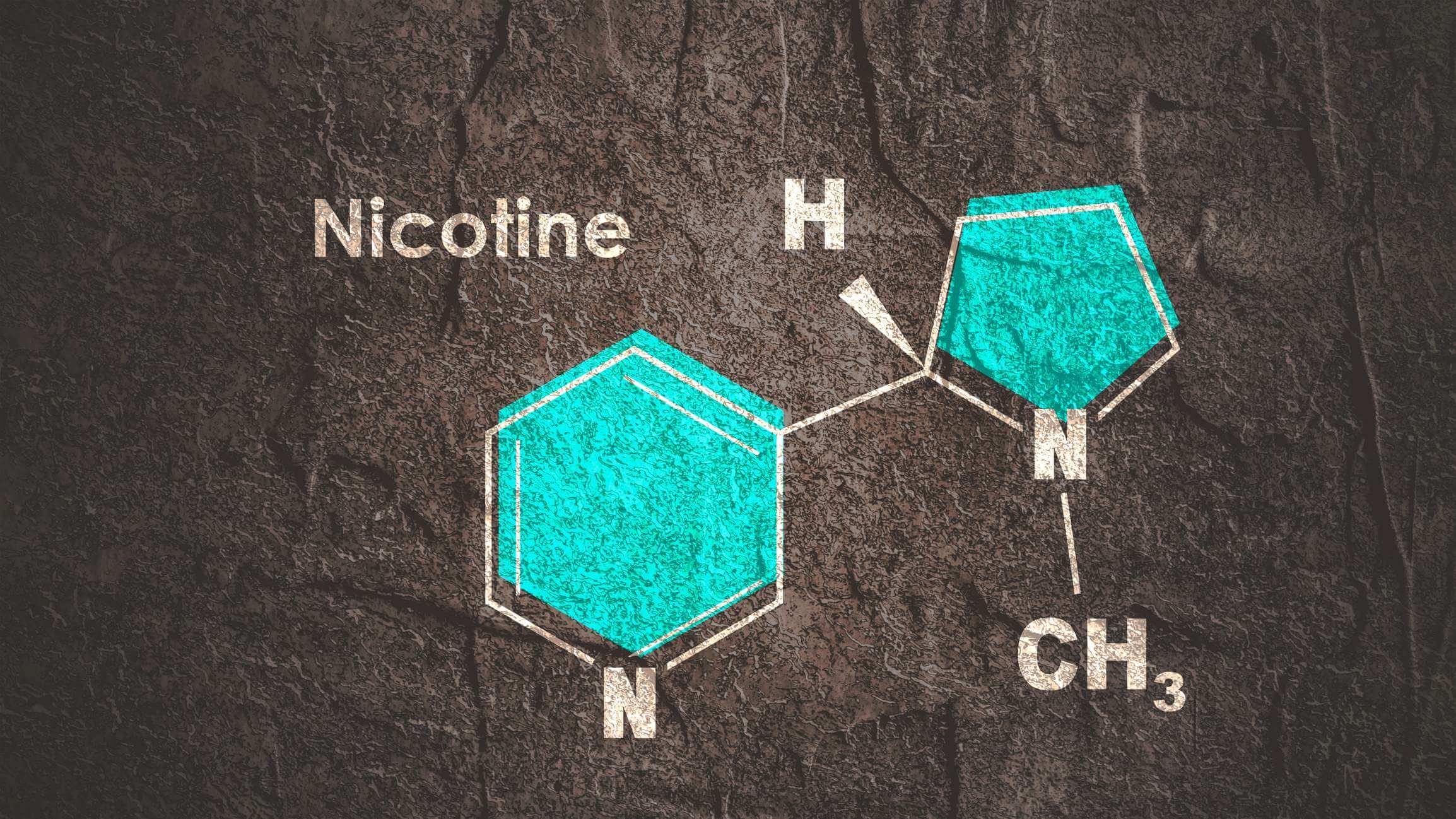
"Wann immer man über Nikotin redet, entsteht in der öffentlichen Meinung eine Diskrepanz", beklagte Univ.-Prof. Dr. Bernd Mayer, Pharmakologe und Toxikologe an der Universität Graz. Auf der "guten" Seite stehen dann die nikotinhaltigen Arzneimittel. Bei ihnen empfiehlt man zumeist, kombinierte Präparate in ausreichender Dosierung – also möglichst viel davon – einzunehmen, damit sie ihre Wirksamkeit voll entfalten können. Sobald das Nikotin aber die Apotheke verlassen hat, "wird das Nikotin tödlich – und zwar nicht nur in der Ansicht von medizinischen Laien, sondern auch von hochrangigen ärztlichen Fachgesellschaften."
In einem Vortrag an der 5. Fachtagung des Instituts für Suchtforschung (ISFF) der Frankfurt University of Applied Sciences skizzierte Mayer, welche Auswirkungen das Nikotin selbst – ohne den Rauch von verbranntem Tabak – wirklich auf die Gesundheit hat.
Kurz- und langfristige Effekte unterscheiden sich
"Der am besten dokumentierte Effekt des Nikotins ist sicher der auf das Herz-Kreislauf-System", berichtete Mayer. Kurzfristig angewendet verursacht das Nikotin hier eine Vasokonstriktion, Erhöhung des Blutdrucks sowie der Herzfrequenz, und eine verstärkte Noradrenalinwirkung. "Diese Veränderungen sind gut dokumentiert und biologisch plausibel", sagte der Experte.
In einer Metastudie fand man in fast allen relevanten Untersuchungen signifikante, aber auch kleine und transiente Erhöhungen dieser Parameter nach dem Gebrauch einer E-Zigarette. Bei dieser Anwendungsform wird das Nikotin über die Verdampfung einer Flüssigkeit (Liquid) aufgenommen – unähnlich der klassischen Tabakzigarette findet dabei aber keine Verbrennung statt. Dokumentiert wurde in einer großen Metaanalyse eine Erhöhung um zwei Pulsschläge pro Minute, 2mmHg beim systolischen und auch beim diastolischen Blutdruck.1
"Diese Änderungen sind zwar signifikant, aber klein. Nur die wirklich relevante Frage ist doch: Was passiert beim langfristigen Konsum von Nikotin?" Zur Beantwortung dieser Frage zog Mayer eine Studie heran, die E-Raucher ein Jahr lang untersuchte – verglichen wurden Anwender von nikotinhaltigen und -freien Liquids.2 Diese chronische Nikotinanwendung liess das Herz-Kreislauf-System im Wesentlichen kalt. "Wenn man einen Unterschied herauslesen will, sieht man eher eine Tendenz zur Erniedrigung des Blutdrucks, aber nicht zu einer Erhöhung."
Eine rezente Arbeit bestätigte diese Ergebnisse: Auch der mittlere arterielle Druck änderte sich mit dem Umstieg von der Zigarette aufs Dampfen mit oder ohne Nikotin, oder auf eine Nikotinersatztherapie (NRT) kaum – die Proband:innen reagierten in den sechs Beobachtungsmonaten stattdessen in allen Gruppen mit einer leichten Senkung.3
Nikotin verursacht keine endotheliale Dysfunktion
Zahlreiche Studien zeigen, dass Verbrennungsprodukte aus der Tabakzigarette vor allem einen Zelltyp schädigen: die Endothelzellen, die die innerste Gefäßschicht auskleiden. Ihre Hauptaufgabe ist die Freisetzung von Mediatoren wie Stickstoffmonoxid, Adenosin und Prostazyklin. Damit steuern sie den Blutdruck und nehmen an Immunprozessen teil. "Fast alle kardiovaskulären Erkrankungen sind assoziiert mit einer Schädigung des Endothels, der endothelialen Dysfunktion. Bekannt ist das vor allem für die Atherosklerose, aber auch beim Diabetes, Bluthochdruck, Schlaganfall oder Thrombosen bei Covid-19 äußern sich die Gefäßschäden vor allem in einer endothelialen Dysfunktion."
Mayer konnte selbst im Zuge einer Forschungsarbeit zeigen, dass die Relaxation isolierter Blutgefäße – ein Maß für die Integrität des Endothels – zwar durch eine Behandlung mit Extrakten aus Tabakrauch fast vollständig eingeschränkt wurde, nicht aber durch Extrakte aus E-Zigaretten. Und das traf auch zu, wenn E-Liquids mit sehr hohem Nikotingehalt angewendet wurden (Wölkart et al., in Vorbereitung). "Das entspricht einem Unterschied im Nikotingehalt von 1:1000 – das Nikotin kann also kaum der Verursacher dieses Effektes sein." Bei der NO-unabhängigen Relaxation, die von der glatten Muskulatur vermittelt wird, gab es hingegen keinen Unterschied in Gegenwart der genannten Extrakte. "Das zeigt, dass es wirklich die Endothelzellen sind, die durch die Inhaltsstoffe von verbrannten Tabakzigaretten beeinträchtigt werden."
Diesen Effekt, so Mayer, kann man auch in vivo beobachten: Rauchen beeinträchtigt die endothelvermittelte flussabhängige Vasorelaxation (Flow-Mediated dilation, FMD), die zumeist im Unterarm gemessen wird.4 "Verstärkt wird das noch durch erhöhte Cholesterinwerte; genau die Risikofaktoren für Atherosklerose, Herzinfarkte und Schlaganfälle."
Unklar war lange, ob die FMD, die bei Nichtrauchern zumeist besser ist, bei Rauchern auch aufgrund des Nikotins eingeschränkt wird. Eine Arbeit aus dem Jahr 2020 zeigte etwa, dass sich die FMD nach 15 Minuten Dampfen geringgradig, aber signifikant, verschlechtert.5 Eine neuere Untersuchung widersprach dieser Studie jedoch. In dieser hatten sowohl nikotinhaltige als auch -freie Liquids keinerlei Effekt auf die FMD.6 "Akute Effekte sind das eine, langfristige das andere", erinnerte Mayer hier wieder. "Und diese zeigen ein ganz anderes Bild." So verbesserte sich die FMD bereits einen Monat nach einem Umstieg von der Tabak- auf eine E-Zigarette.7 Eine neuere Arbeit zeigt, dass diese Verbesserungen zumindest über einen Nachbeobachtungszeitraum von sechs Monaten aufrecht blieben.
Kardiovaskuläres Risiko durch Nikotin nicht erhöht
Dass auch das kardiovaskuläre Risiko nicht durch Nikotin erhöht wird, zeigen drei Metaanalysen zur Anwendung von Nikotinersatzpräparaten. "Es spricht also nichts dafür, dass Nikotin jedwede Schädigungen des Herz-Kreislauf-Systems verursacht", so Mayer. Für ihn empfiehlt sich damit auch ein Umstieg auf die E-Zigarette, da Raucher dadurch ihre Endothelfunktion verbessern können.
Aus Sicherheitsgründen ausgenommen von dieser Empfehlung sind allerdings kardiovaskulär vorerkrankten Personen – obwohl es bislang dafür keinerlei Evidenz gibt. Auch Menschen mit einer Tumorerkrankung sollten Nikotin nicht übermäßig anwenden, sagte Mayer: "In Tierversuchen konnte nachgewiesen werden, dass Nikotin die Angiogenese und damit auch das Tumorwachstum fördert. Das ist auch biologisch plausibel."
Nicht evidenzbasiert sind hingegen die Behauptungen einer negativen Beeinflussung der Embryonalentwicklung, der Schädigung des Gehirns von Jugendlichen, der Kanzerogenese und eines erhöhten Atherosklerose-Risikos durch Nikotin.
Abhängig von Zigaretten, nicht vom Nikotin
Nikotin hat auch positive Wirkungen auf die Gesundheit, so Mayer. Dazu gehört etwa sein stimmungsaufhellender Effekt sowie die Verbesserung der Denkleistung und der Konzentration. Damit in Verbindung steht aber auch das Abhängigkeitspotenzial von Nikotin. Neuronal ist etwa bekannt, dass Nikotin eine Dopaminfreisetzung im Nucleus accumbens, dem Belohnungszentrum im Gehirn, verursacht, und damit das Belohnungs-Erwartungs-System stimuliert – "ein typisches Charakteristikum einer Abhängigkeit erzeugenden Substanz".
Dass die Abhängigkeit von der Zigarette aber allein durch Nikotin bedingt ist, bezweifelt mittlerweile nicht nur Mayer. So benannte Dr. Karl Fagerström, der in den 1970er-Jahren den ersten Test zur Nikotinabhängigkeit entwickelt hatte, diesen im Jahr 2012 in "Fagerström Test for Cigarette Dependence" um. Auch in Tierexperimenten konnte man sehen, dass Nikotin alleine "sehr lausig" darin ist, Abhängigkeit zu erzeugen – erst andere Inhaltsstoffe des Tabaks, wie Monoaminooxidase (MAO)-Hemmer, steigern das Suchtpotenzial des Nikotins so, dass es relevante Ausmaße annimmt.
Verhaltensabhängigkeit steht im Vordergrund
Was dazukommt, und für Mayer bei vielen Raucher:innen wahrscheinlich dominiert, ist die Verhaltensabhängigkeit in Form eines konditionierten "Rauchrituals". Dazu gehört etwa die Handhaltung, die Haptik der Zigarette, das Inhalieren und das Ausatmen. Auch die Reizung der oberen Atemwege, der "Throat hit", also "das Gefühl, dass etwas in den Atemwegen ankommt", ist ein Faktor, der das Rauchen für Zigarettenkonsumenten, aber auch für E-Zigarettenkonsumenten attraktiv macht.
Das ist für Mayer auch der Grund, warum Nikotinersatzpräparate alleine (ohne Verhaltenstherapie) in der Praxis oft nicht ausreichend wirksam sind. Orale Tabakprodukte wie Snus enthalten neben dem Nikotin auch noch andere Tabakinhaltsstoffe, sind daher in einigen Ländern weitaus beliebter als die NRT. E-Zigaretten erlauben zusätzlich auch noch, das Verhalten aufrecht zu erhalten. "Das wird den E-Zigaretten sogar von manchen Public-Health-Experten angekreidet, aber in Wahrheit fällt den Rauchern daher der Umstieg leichter."
- Skotsimara G et al. Eur J Prev Cardiol. 2019 Jul;26(11):1219-1228. doi: 10.1177/2047487319832975.
- Farsalinos K et al. Intern Emerg Med. 2016 Feb;11(1): 85–94. doi: 10.1007/s11739-015-1361-y.
- Klonizakis M et al. BMC Med. 2022 Aug 16; 20(1): 276. doi: 10.1186/s12916-022-02451-9.
- Heitzer T et al. Circulation. 1996 Apr 1; 93(7): 1346–1353. doi: 10.1161/01.cir.93.7.1346.
- Kuntic M et al. Eur Heart J. 2020 Jul 7; 41(26): 2472–2483. doi: 10.1093/eurheartj/ehz772.
- Haptonstall KP et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2020 Sep 1; 319(3): H547–H556. doi: 10.1152/ajpheart.00307.2020
- George J et al. J Am Coll Cardiol. 2019 Dec 24; 74(25): 3112–3120. doi: 10.1016/j.jacc.2019.09.067.
