
Diabetes-Strategie: Diabetes wird zum Politikum
Experten setzen große Hoffnungen in die neue österreichische Diabetes-Strategie. Wie viel davon in der Praxis ankommen wird, bleibt abzuwarten. Der Spielball liegt nun bei der Politik. (Medical Tribune 16/2017)
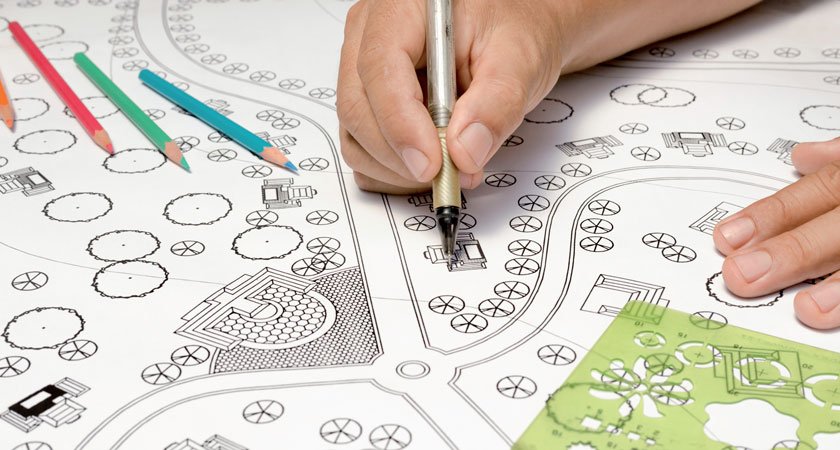
Etwa 600.000 Menschen sind in Österreich bereits an Diabetes erkrankt. Durch Übergewicht und Bewegungsmangel sind viele weitere gefährdet. Umfassende Maßnahmen, die sowohl den Erkrankten als auch den Risikogruppen zugute kommen, sind daher dringend gefordert. „Viel Zeit haben wir nicht, Prozesse zu implementieren, sonst werden uns die Zahlen an Diabetes sozusagen erschlagen“, mahnt Univ.-Prof. Dr. Hermann Toplak, Präsident der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG), anlässlich der Präsentation der neuen österreichischen Diabetes-Strategie.
Hochgesteckte Ziele
Sechs Wirkungsziele und 18 Handlungsempfehlungen sollen dazu beitragen, zwei übergeordnete Ziele zu erreichen:
Ziel 1: Für alle in Österreich lebenden Menschen die Wahrscheinlichkeit verringern, an Diabetes zu erkranken.
Ziel 2: Alle in Österreich lebenden und an Diabetes erkrankten Menschen sollen möglichst lange mit hoher Lebensqualität leben können. Damit diese hehren Ziele tatsächlich in der Praxis ankommen können, ist einiges an politischem Commitment erforderlich. Besonders das Ziel, das Diabetesrisiko aller Österreicher zu senken, hat als sogenannter „Health in All Policies“-Ansatz einen sehr umfassenden Anspruch und soll, zumindest wenn es nach den Stakeholdern der Diabetes-Strategie geht, zukünfig sogar in der Stadtplanung mit bedacht werden.
„Natürlich kann man das in die Verantwortung jedes Einzelnen delegieren und sagen, das Wissen ist ja da und es soll sich halt jeder vernünftig ernähren und bewegen“, so Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher, Fachbereichsleiter der Diabetesambulanz am Wiener Hanusch-Krankenhaus und Past-President der ÖDG. Doch sei es die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass das Umfeld möglichst wenig Risiko birgt, dass Menschen in Zukunft an Diabetes erkranken. „Viele von uns Diabetologen sagen immer wieder: Steigen Sie doch zwei Stationen früher aus der U-Bahn aus und gehen Sie zu Fuß. Jeder Schritt zählt“, berichtet Wascher und erklärt: „Das ist zwar nett, aber nur dann, wenn die Gegend, wo ich mich bewege, sicher ist und zur Bewegung einlädt.“
Auch in der Versorgung bereits Erkrankter orten die Experten noch einiges an Verbesserungsbedarf. Im Kleinen gebe es schon viele Projekte, die gut funktionieren, so Prim. Dr. Claudia Francesconi, Ärztliche Leiterin der Sonderkrankenanstalt Rehabilitationszentrum Alland, doch an flächendeckender guter Versorgung, die allen Betroffenen, unabhängig von Wohnort und sozioökonomischer Schicht, zugute komme, mangle es noch. Mit der Diabetes-Strategie ist nun, zumindest in der Theorie, der Grundstein gelegt. Zukünftig wird sie an ihrer Umsetzung in der Praxis gemessen werden. „Eine Strategie ist in Wirklichkeit eine Idee. Wenn aus dieser Idee keine Umsetzung wird, hätte man sich die Idee sparen können“, spitzt Wascher zu.
Ob es bei einem geduldigen Papier bleibt oder vieles davon in der Praxis ankommen wird, werden wohl politischer Wille und Finanzierung entscheiden. Dazu Francesconi: „Wenn man sagt, die integrative Versorgung funktioniert nach dem derzeitigen Prinzip nicht, dann muss man sich natürlich gleichzeitig fragen, warum funktioniert sie nicht. Und einer der Gründe liegt einfach in der fehlenden Finanzierung von manchen Leistungen.“ Dass die Umsetzung ausschließlich mit Mehrkosten assoziiert sei, glaubt Toplak nicht: „Es ist oft eine Frage der Organisation und der Umwidmung von Mitteln, die derzeit im Gesundheitssystem zum Teil ausgegeben werden.“
In diese Kerbe schlägt auch Francesconi mit ihrer Kritik: „Es wird nie wirklich die Gesamtrechnung aufgestellt. Der Einzelpunkt wird betrachtet, ob das jetzt Medikamentenkosten sind oder Kosten für Heilmittel, es werden nie die Gesamtkosten betrachtet.“ Vieles, das zuerst Mehrkosten verursache, würde sich durch die Reduktion von Komplikationen langfristig rechnen. Das unterstreichen auch die Zahlen, die Toplak anführt: So verursacht ein gut eingestellter Diabetiker pro Jahr etwa 3000 Euro an Kosten im Gesundheitssystem, ein „mittelgut“ eingestellter schon 8000 Euro und ein schlecht eingestellter 30.000 Euro, wobei „Dialysen und Amputationen noch nicht mit eingerechnet sind“. Das Fazit Toplaks: „Einen schlecht eingestellten Diabetiker können wir uns nicht leisten.“
Diabetes-Strategie zum Download:
www.bmgf.gv.at/home/Diabetes
Die Wirkungsziele
Wirkungsziel 1: Steigern der diabetesbezogenen Gesundheitskompetenz:
Gefordert wird breit angelegte Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit.
Wirkungsziel 2: Diabetesreduzierende Umwelt-/Umfeldfaktoren fördern:
Ein Wirkungsziel mit großen Implikationen: Sogar die Stadtplanung soll das Thema Diabetes zukünftig mitbedenken. Zielsetzung ist eine Umgebung, die zur Bewegung einlädt. Damit könnte auch anderen Erkrankungen vorgebeugt werden.
Wirkungsziel 3: Erkrankte zum eigenständigen Umgang mit Diabetes befähigen:
Hintergrund: Wer seine Erkrankung akzeptiert und versteht, kann besser damit umgehen. Wichtig ist auch die Einbindung von Angehörigen und beruflichem Umfeld.
Wirkungsziel 4: Integrierte Versorgung sicherstellen:
Jeder Patient, soll unabhängig von Wohnort und sozioökonomischem Hintergrund, Zugang zu integrierter Versorgung haben.
Wirkungsziel 5: Wissen und Kompetenz der Gesundheitsberufe ausbauen, vernetzen und transparent machen:
Diabetesrelevante Inhalte sollen in Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Gesundheitsberufe integriert werden.
Wirkungsziel 6: Wissen generieren und evidenzbasiertes, qualitätsgesichertes Handeln unterstützen:
Forschung, Vernetzung und Wissenstranfer sollen gefördert werden. Für die Versorgung soll ein Qualitätsmanagement etabliert werden.