OP-Wartezeiten
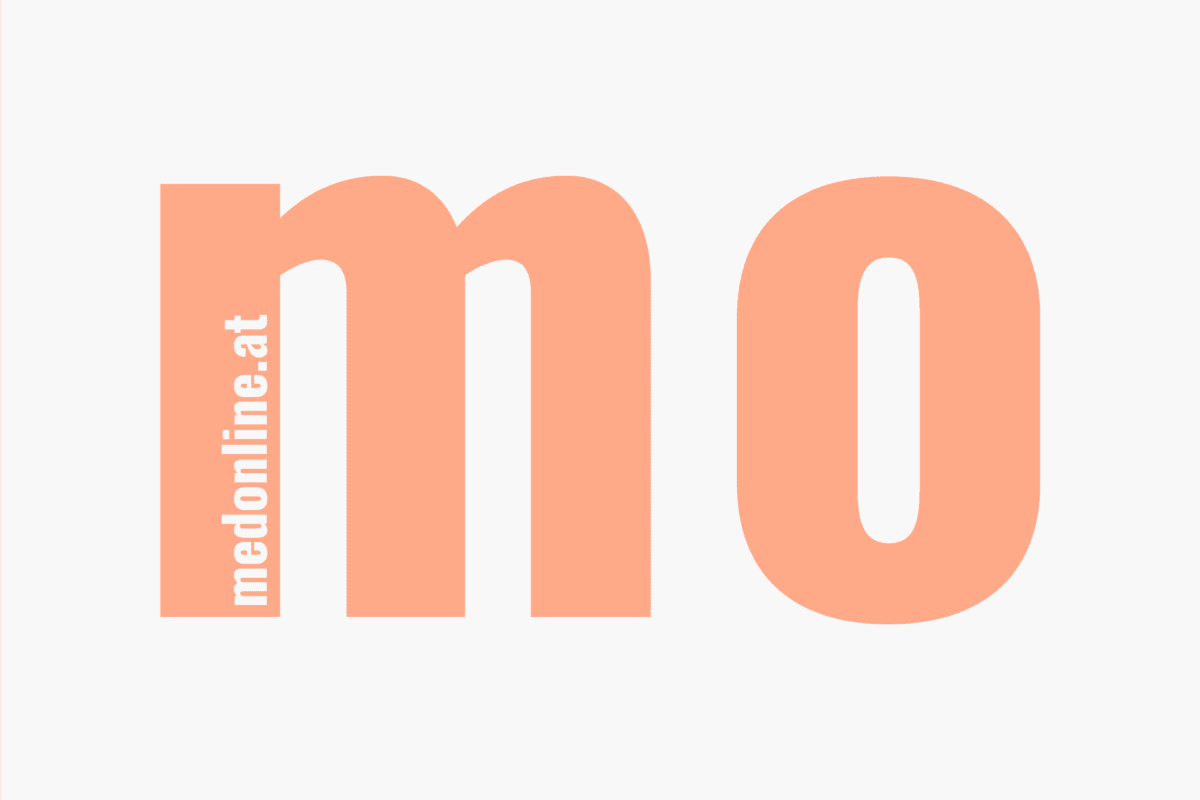
Sie werden zwar in den Spitälern und vom Ministerium erhoben, doch nach wie vor nicht veröffentlicht: Wartezeiten. Im Jahr 2011 wurden die Kliniken zu einem Wartezeitenmanagement verpflichtet. Doch noch immer gibt es Debatten über Bevorzugungen.
Für private Krankenversicherer ist im Grunde klar: Hauptmotiv, warum sich Menschen in Österreich eine Zusatzversicherung zulegen, ist die Möglichkeit, dadurch bevorzugt behandelt zu werden. Genau das sollte es aber eigentlich nicht geben. Nach jährlich wiederkehrender Kritik an der Bevorzugung von privatversicherten Patienten wurde bereits 2011 für alle Spitäler ein verpflichtendes Wartezeitenmanagement eingeführt. Als großen Erfolg bezeichnete damals SPÖ-Gesundheitssprecherin und heutige Gesundheitsministerin Dr. Sabine Oberhauser den Beschluss im parlamentarischen Gesundheitsausschuss: „Damit wird bei der Vergabe von OP-Terminen etwaige Tendenzen in Richtung Zwei-Klassen-Medizin ein Riegel vorgeschoben.“ Das Wartezeitenmanagement ist ein wesentlicher Teil der Gesundheitsreform und zielt auf mehr Transparenz in den Spitälern ab. Für geplante OPs gibt es transparente Listen, auf denen anonymisiert ersichtlich ist, wie lange man auf bestimmte OPs warten muss. Veröffentlicht werden die Listen bis dato nicht. Konsequenzen für lange Wartezeiten ebenso wenig. Das Gesundheitsministerium versucht vielmehr, anhand der Daten die Ergebnisse zu verbessern. Fachleute vergleichen Parameter und Abläufe und gehen dann in die Bundesländer, um mit den Verantwortlichen zu reden und Verbesserungspotenziale zu suchen.
Trotz allem scheint sich bisher wenig bewegt und verbessert zu haben. Nicht zuletzt weil oft die Kapazitäten fehlen. Im April gab es etwa einen Aufschrei der Radioonkologen beim Kongress der europäischen Fachgesellschaft. „In Österreich sterben Krebspatienten, weil die notwendigen Kapazitäten für eine Strahlentherapie fehlen“, so die Warnung. „Man kann davon ausgehen, dass man pro vier Wochen Wartezeit auf eine Strahlenbehandlung um zehn bis 20 Prozent geringere Heilungschancen hat“, sagte der Wiener Strahlentherapeut Univ.-Doz. Dr. Robert Hawliczek. Die Misere wurde heuer zu Jahresbeginn auch in einer europäischen Vergleichsstudie in „Lancet Oncology“ kritisiert. Die Daten dazu sind allen Gesundheitspolitikern, so dieExperten, längst bekannt. Die Onkologen kritisierten, dass v.a. die Bundesländer als Spitalserhalter die Vorgaben des Österreichischen Strukturplans Gesundheit nicht einhalten. Die Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Radioonkologie (ÖGRO), Univ.-Prof. Dr. Karin Kapp, rechnete vor, dass es in Österreich derzeit 43 Linearbeschleuniger für die Strahlentherapie an den Spitälern gibt. Nehme man die vom ÖSG genannte obere Schwelle von einem Gerät pro 100.000 Einwohner, sollten es rechnerisch über 80 sein. Bei der unteren Schwelle von einem Gerät pro 140.000 Einwohner müssten es zumindest 60 sein. Univ.-Prof. Dr. Richard Pötter, Chef der Wiener Universitätsklinik für Strahlentherapie, analysierte die daraus resultierenden Wartezeiten: „Wir haben bei Brustkrebspatientinnen Wartezeiten von zwei bis drei Monaten, ebenso bei Prostatakarzinompatienten.“
An sich sollten durch das Wartezeitenmanagement die Termine von öffentlichen und privaten gemeinnützigen Spitälern v.a. für geplante Katarakt-, Bandscheiben-, Hüft- und Knieendoprothesen elektronisch offengelegt sein. Nicht zuletzt weil Spitalsärzte mit Privatordinationen bisher oft für ihre Patienten pauschal OP-Termine reserviert hatten. Zumindest das sei durch das Wartezeitenmanagement nicht mehr möglich, heißt es aus dem Ministerium.