Fortschritte in der Behandlung des NSCLC
Im Bereich der pneumo-onkologischen Forschung tut sich so einiges – auch in Österreich geht es voran. Inzwischen stehen zahlreiche Optionen für die Behandlung des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) zur Verfügung. Hierzulande ist es eine absolute Ausnahme, wenn jemand – auch schon im Frühstadium der Erkrankung – nicht mit einer Chemo-Immuntherapie behandelt wird.
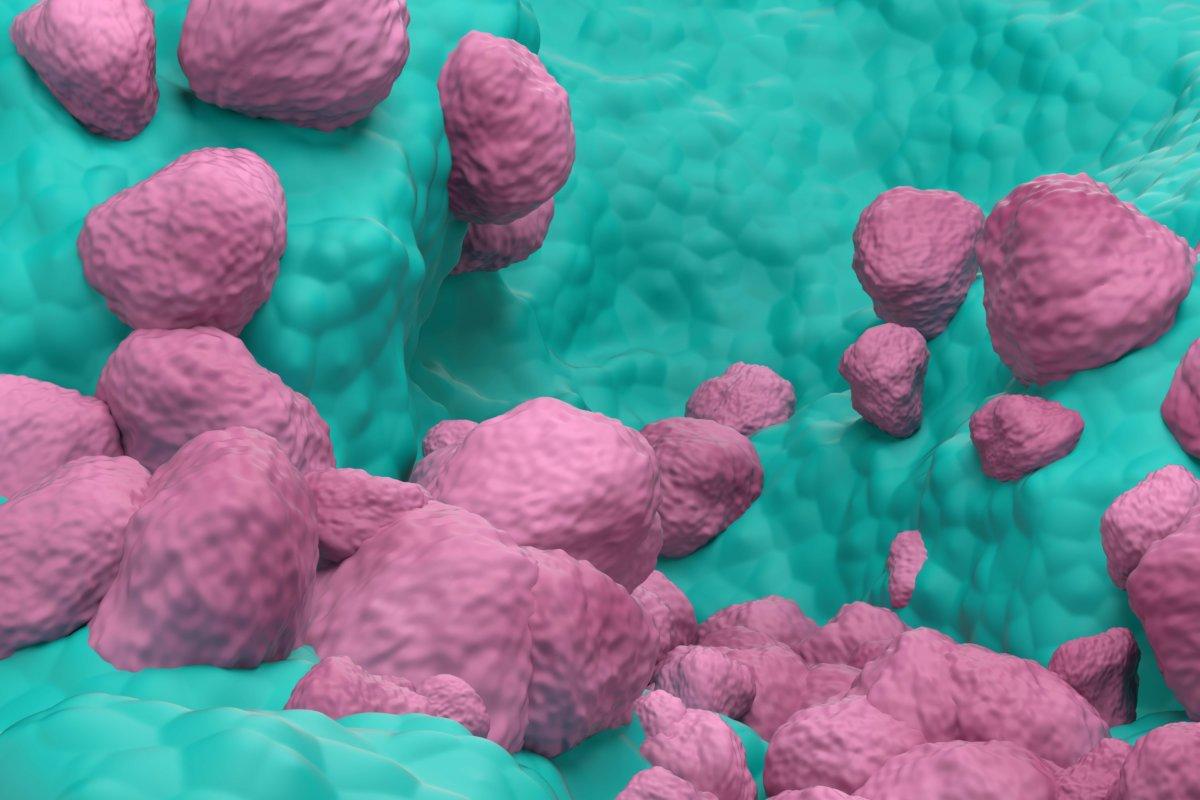
In den letzten 20 Jahren haben sich die 2-Jahres-Überlebenskurven von Patientinnen und Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) annähernd verdoppelt. Dieser Fortschritt ist vor allem der Entwicklung der systemischen Therapie zu verdanken, erklärt OA Dr. Maximilian Hochmair von der pneumo-onkologischen Ambulanz der Klinik Floridsdorf (Wien) im Rahmen der 11. Pneumo Aktuell-Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP). Das heißt allerdings nicht, dass die Betroffenen eine Heilung erwarten können. Versucht wird, gezielter einzugreifen, um Nebenwirkungen zu reduzieren und ein besseres Gesamtüberleben zu erreichen.
Zusammenarbeit mit Pathologie kommt große Bedeutung zu
Während noch vor einigen Jahren die einzige Therapieoption eine einheitliche Chemotherapie war, bestehen inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, um NSCLC zu behandeln. Für Patientinnen und Patienten ohne bestimmte Driver-Mutation stehen verschiedenste Immuntherapien zur Verfügung. Für Personen, bei denen im standardmäßig durchgeführten „next generation sequencing“ (NGS)-Report eine Driver-Mutation detektiert wird, kommen immer mehr zielgerichtete Therapien auf den Markt. „Heutzutage frage ich nicht mehr, ob eine EGFR-Mutation vorhanden ist, sondern wenn ja, um welche Art der EGFR-Mutation es sich handelt und welche Zusatzmutationen zu finden sind“, berichtet Hochmair. Denn es gibt auch bestimmte Mutationskombinationen, die einen prognostisch ungünstigeren Faktor darstellen. Das ist auch der Grund, warum eine enge Zusammenarbeit mit der Pathologie immer wichtiger wird. „Wir müssen herausfinden, wer wovon profitiert, wer mehr Therapie braucht und wer weniger Therapie braucht“, so der Experte.
